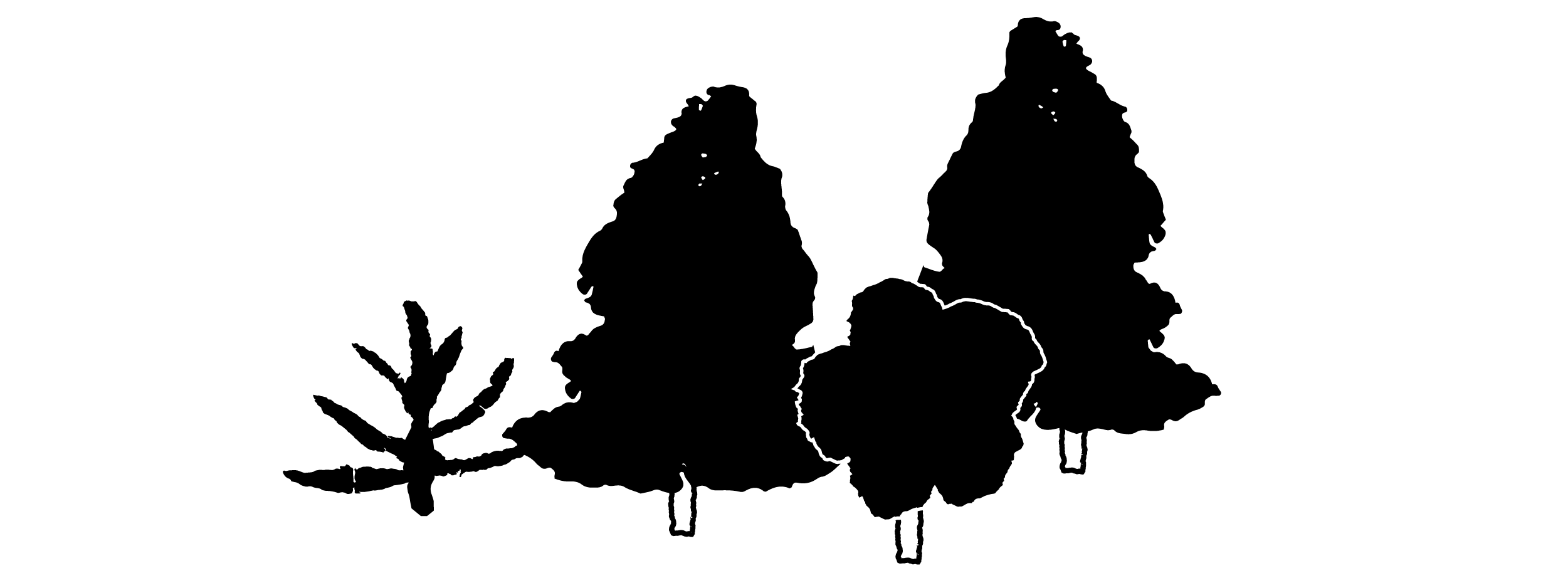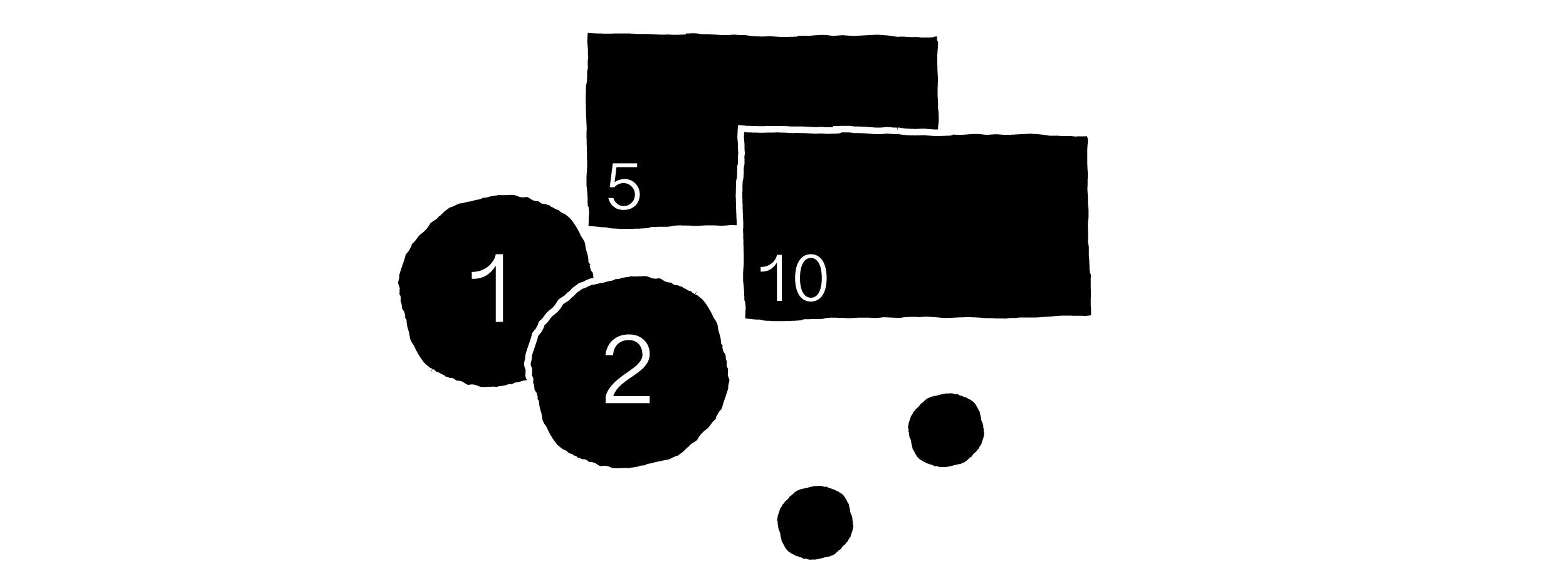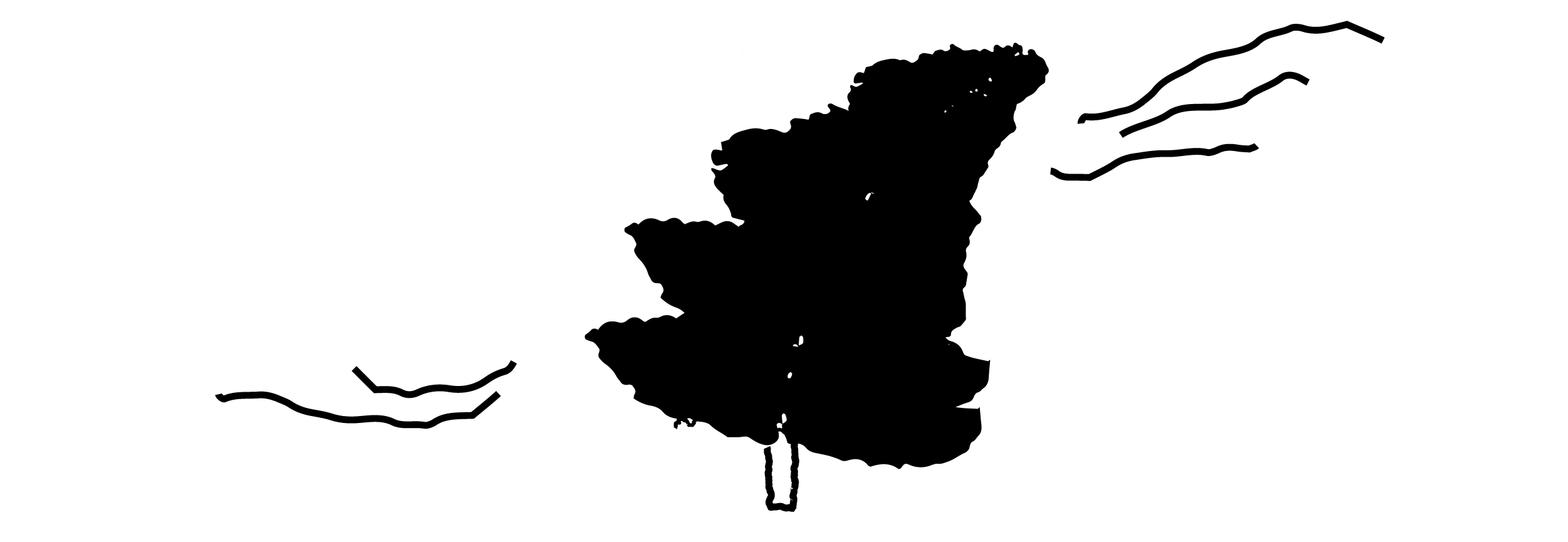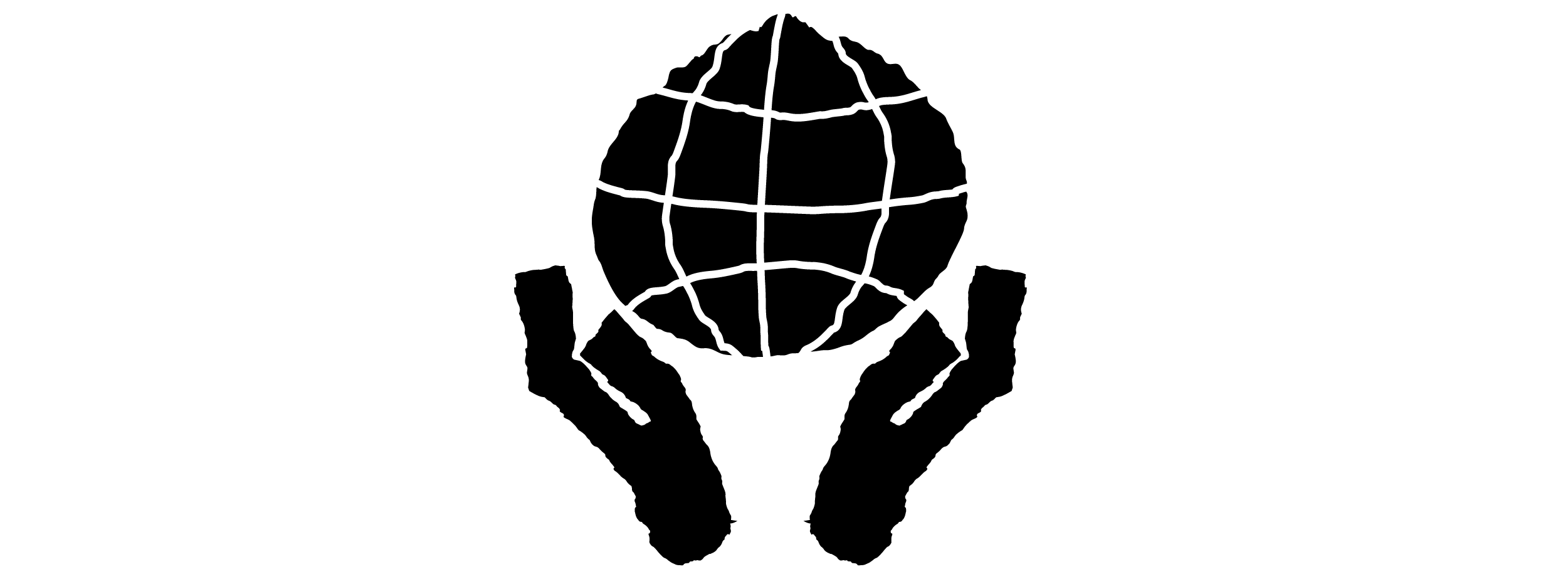Die Website ist ein Archiv für unser Projekt Das Brotbaum·regime.
Ein Archiv ist eine Sammlung.
Wir haben hier Informationen über das Projekt gesammelt.Und Informationen zu unserer Ausstellung.
Außerdem gibt es viele Informationen zu den Themen Wald und Kultur.
Ökosystemgerechter Umgang mit Wald
Ökosystem – ein Wort in aller Munde, doch was genau bezeichnet der Begriff? Das Wort Ökosystem kommt aus dem Altgriechischen (oikós) und bedeutet „das Verbundene“. Es gibt verschiedene Blickwinkel, aus denen heraus ein Ökosystem definiert wird: Der biologisch orientierte betrachtet einen bestimmten Organismus als Mittelpunkt des Ökosystems und die übrigen Ökosystemkomponenten als Basis für seine Ressourcen. Ein anderer Ansatz konzentriert sich auf die Vernetzung der Organismen untereinander und die miteinander verwobenen Stoff- und Energieflüsse. Die dritte Sichtweise sieht Ökosysteme als geografische Orte, als Gebiete von ähnlicher Topografie, ähnlichem Klima und mit ähnlicher Flora und Fauna. Eine aktuell häufig verwendete Definition ist die der Biodiversitätskonvention, die ein Ökosystem als einen „dynamischen Komplex von Gemeinschaften aus Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen sowie deren nicht lebender Umwelt, die als funktionelle Einheit in Wechselwirkung stehen“ beschreibt. Ein Kernbegriff dieser Beschreibung ist „dynamisch“, was besagt, dass ein Ökosystem niemals starr ist, sondern sich stetig wandelt und Stabilität immer nur relativ und zeitlich begrenzt ist. Jedes Ökosystem hat zwar ein ihm eigenes „ökologisches Gleichgewicht“, doch auch dieses ist bei näherem Hinsehen dynamisch, ein stetiges Zusammenspiel vielfältiger und vielschichtiger Wechselwirkungen, darunter auch Störungen und das darauffolgende Zurückfinden ins Gleichgewicht. Ein Ökosystem hat in der Regel ein ihm eigenes Störungsregime, an das es angepasst ist. Kommt es jedoch zu erheblichen „systemfremden“ Störungen, greifen die Anpassungsstrategien seiner Organismen unter Umständen nicht und das natürliche Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht. Nach einer gewissen Zeit entsteht ein neues, oft jedoch labileres Gleichgewicht und ein neues, mehr oder weniger „naturfernes“ Ökosystem, das aufgrund der geringeren Anpassung an die natürlichen Bedingungen störungsanfälliger ist als sein „naturnaher“ Vorgänger. – Es ist ähnlich wie bei uns Menschen: Leben wir nicht in unserem Optimum, erfahren auch wir Stress und sind weniger resilient gegenüber negativen Einflüssen, zum Beispiel werden wir leichter krank. Leben wir hingegen in für uns annähernd optimalen Bedingungen, können wir Störungen leichter abpuffern.
Im ursprünglichen, wissenschaftlichen Sinn wird der Begriff „Ökosystem“ wertungsfrei verwendet. In der Praxis, vor allem im Naturschutzkontext, wird jedoch oft zwischen mehr oder weniger wertvollen Ökosystemen unterschieden. In die erste Kategorie fallen dabei in der Regel Ökosysteme mit einer natürlicherweise hohen oder sehr spezifischen Artenvielfalt, die einem geringen menschlichen Einfluss ausgesetzt sind. Denn durch den Erhalt solcher natürlichen oder naturnahen Ökosysteme kann ein wichtiger Beitrag zum Erhalt der weltweit zurückgehenden Biodiversität geleistet werden. In unserer menschlich überprägten Nutzlandschaft sind naturnahe Ökosysteme selten geworden. Städte zum Beispiel sind eine besonders massive Umgestaltung der natürlichen Landschaft, durch die sich völlig neue Ökosysteme etabliert haben. Im ländlichen Raum haben offene Weide- und extrem artenarme Ackerlandschaften die ursprüngliche Waldlandschaft weitestgehend verdrängt (Deutschland wäre ohne menschlichen Einfluss auf die Natur zu mehr als 90% mit Wald bedeckt). Bei den verbliebenen Wäldern (noch circa ein Drittel der Bundesfläche) handelt es sich in den meisten Fällen nicht mehr um die ursprünglich an die örtlichen Gegebenheiten wie Temperatur, Niederschlag oder Bodenart angepassten Waldtypen, sondern um naturferne Forste. Den größten Teil davon bilden deutschlandweit Fichten- und Kiefern-Monokulturen. Während beide Baumarten unter natürlichen Bedingungen jeweils nur rund 1% der Waldfläche dominieren würden, nehmen sie heute jeweils rund ein Viertel der Fläche ein. Das Problem labiler Ökosysteme ist somit allgegenwärtig.

Das gilt auch für das Sauerland, das natürlicherweise vor allem von Hainsimsen-Buchenwäldern, vereinzelt auch von mäßig basenreichen bis basen- und kalkreichen Buchenmischwäldern und Schluchtwäldern geprägt wäre. Der Anteil an naturfernen Fichtenwäldern ist hier besonders hoch und macht regional bis zu zwei Drittel der Waldfläche aus. Dass große Teile der Wälder nicht optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst sind und sich daher nicht in ihrem ökologischen Optimum befinden, hat sich in den vergangenen Jahren deutlich gezeigt: Durch den zusätzlichen Stress aufgrund langer Trockenperioden und erhöhter Temperaturen waren die Fichten vielerorts nicht mehr in der Lage, sich gegen Fressfeinde wie den Borkenkäfer zu wehren und wurden leichte Beute. Die gängigen forstlichen Eingriffe in diesem Fall verschlimmern die Situation oft noch, etwa indem die befallenen Bäume zu einem Zeitpunkt von den Flächen entfernt werden, zu dem die Borkenkäferlarven bereits von Fressfeinden befallen sind, und diese so mit abgeräumt werden. Doch auch Wälder mit naturnaher Baumartenausstattung haben unter den extremen Wetterbedingungen gelitten. In vielen Fällen waren auch hier Eingriffe in die natürlichen Strukturen ursächlich: Beispielsweise wird aufgrund einer durch forstliche Eingriffe stark verringerten Baumdichte die Sonneneinstrahlung am Boden erhöht. Die Verdunstung nimmt daher zu und die Böden können weniger Feuchtigkeit speichern, während die Bäume zudem durch das größere Platzangebot größere Kronen ausbilden und dadurch einen erhöhten Wasserbedarf haben. Um stabile und „verlässliche“ Naturlandschaften zu erhalten, ist es also sinnvoll, möglichst gut angepasste, also natürliche und dadurch resiliente Systeme anzustreben.
Auch im Sauerland gilt es nun zu entscheiden, wie mit den großen, abgestorbenen Waldflächen umzugehen ist und was für Wälder dort künftig wachsen sollen. Wieder auf das gleiche naturferne System zu setzten, ist wenig erfolgversprechend. Darüber, dass die Wälder der Zukunft möglichst resilient sein sollen, herrscht weithin Konsens. Uneinigkeit besteht hingegen darüber, ob dies durch das weitestmögliche Zulassen natürlicher Etablierungs- und Anpassungsprozesse zu erreichen ist und der Mensch möglichst wenig in diese Prozesse eingreifen sollte oder ob die zukünftigen Wälder zu großen Teilen nach menschlichem Ermessen „designed“ und „gepflegt“ werden sollten. Der erstgenannte Ansatz würde sich auf die Anpassungsfähigkeit der heimischen Baumarten und auf naturnahe Strukturen verlassen, während im zweiten Fall auch auf nicht-heimische Baumarten aus Regionen, die den hier prognostizierten klimatischen Bedingungen möglichst entsprechen, gesetzt würde. Ob es die heimischen Arten schaffen werden, sich an das schnell wandelnde Klima anzupassen, lässt sich nicht mit absoluter Sicherheit sagen. Doch durch das Zulassen natürlicher Reproduktionszyklen mit natürlicher Auslese besteht die Chance auf optimal angepasste und resiliente Ökosysteme. Das Einbringen nicht derartig angepasster Baumarten birgt immer ökologische Risiken, die im Vorhinein nicht kalkulierbar sind. Dies gilt vor allem im Hinblick auf die Komplexität von Ökosystemen. Die Eignung einer Art aufgrund ihrer Kompatibilität mit einigen wenigen Systemkomponenten wie Temperatur, Niederschlagsmenge und Bodenbeschaffenheit zu entscheiden, greift zu kurz. Die ökosystemaren Netzwerke sind vielschichtig und viele Zusammenhänge bestehen nur indirekt, sind nicht offensichtlich und teilweise nicht einmal ausreichend bekannt, geschweige denn verstanden. Diese Komplexität und unsere Wissenslücken gilt es anzuerkennen und bei Entscheidungen zu berücksichtigen.